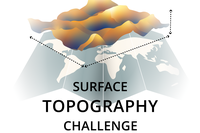Die Herausforderung, wahre Oberflächenrauheit zu erfassen
Wer schon einmal auf einem glatten Boden ausgerutscht ist oder seine Reifen im Schnee hat durchdrehen sehen, weiß intuitiv, wie wichtig Oberflächen sind. Die Eigenschaften von Oberflächen werden maßgeblich durch deren Rauheit bestimmt, die oft nur mit einem Mikroskop beobachtet werden kann und der Topografie von Berglandschaften ähnelt. In der Industrie – sei es beim Bau von Robotern, der Entwicklung von Laufschuhen oder der Herstellung von Halbleitern – ist die Bedeutung von Oberflächenrauheit längst unbestritten. Und doch: Trotz ihrer zentralen Rolle wird Rauheit höchst unterschiedlich gemessen und beschrieben.
Lars Pastewka von der Universität Freiburg und Tevis Jacobs von der University of Pittsburgh haben zusammen mit Martin Müser von der Universität des Saarlandes und Jacobs’ Doktorandin Arushi Pradhan haben in einem weltweiten Wettbewerb internationale Forschungsgruppen dazu aufgefordert, zwei standardisierte Oberflächen zu vermessen. Ziel war es, mehr Bewusstsein für die Messung und Beschreibung von Oberflächentopografien zu schaffen und systematische Unterschiede zwischen Messprinzipien zu erfassen. Die Ergebnisse ihrer Forschung wurden im Artikel “The Surface-Topography Challenge: A multi-laboratory benchmark study to advance the characterization of topography” (DOI: 10.1007/s11249-025-02014-y) veröffentlicht.
Jacobs, Inhaber des William Kepler Whiteford Lehrstuhls für Maschinenbau und Werkstoffwissenschaften, erforscht die Funktionsweise von Oberflächen – insbesondere Haftung, Reibung und Verschleiß – mit Anwendungen, die von der Vermeidung von Sturzunfällen über medizinische Geräte bis hin zur Fertigung von Computerchips reichen. All diese Anwendungen hängen direkt von der Rauheit ab – und schon kleine Unterschiede können das Verhalten eines Bauteils massiv beeinflussen.
„Rauheit ist bis in den Nanometerbereich relevant“, sagt Jacobs. In der Robotik etwa hängt die Fähigkeit eines Greifers, empfindliche Gegenstände aufzunehmen, davon ab, wie die Oberfläche auf verschiedenen Längenskalen beschaffen ist. Doch, so Jacobs weiter: „Keine einzelne Messung kann eine Oberfläche vollständig erfassen.“
„Die industriellen Standardverfahren zur Rauheitsmessung können zwar Veränderungen an Prozessbedingungen erfassen, liefern aber nur begrenzte Informationen zu funktionalen Eigenschaften von Oberflächen wie zum Beispiel deren Reibung“, ergänzt Pastewka, Professor für Mikrosystemtechnik und langjähriger Forschungspartner von Jacobs.
In der wissenschaftlichen Forschung werden daher oft bewusst andere, genauere und komplexere Messmethoden verwendet. Das Problem dabei: Es gibt eine Vielzahl an Werkzeugen, Techniken und mathematischen Modellen – und jede Forschungsgruppe geht anders vor.
„Man kann es mit dem Gleichnis von den blinden Männern und dem Elefanten vergleichen“, sagt Jacobs. „Jeder tastet einen anderen Teil des Tieres ab und beschreibt etwas völlig anderes. Genauso misst jeder Forscher einen anderen Aspekt der Oberfläche – mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen.“
Ein Wettbewerb für die Wissenschaft
Im Jahr 2015 startete Martin Müser eine erste sogenannte Contact-Mechanics Challenge. Er generierte eine künstliche, rechnerisch erzeugte Oberfläche und verschickte deren Daten an Forschungsteams weltweit. Diese sollten mit beliebigen Modellen und Rechenmethoden bestimmte Eigenschaften der Oberfläche berechnen und ein Haftungsproblem lösen. Anschließend wurden die Ergebnisse verglichen und bewertet.
Dieser Wettbewerb war ein Meilenstein für die theoretische Modellierung rauer Oberflächen – und inspirierte Jacobs und Pastewka zu einer weiterführenden Idee: Was wäre, wenn wir das mit echten Oberflächen machen?
Bei einer Gordon Research Conference im Jahr 2022 verkündeten Jacobs, Pastewka, Müser und der Postdoktorand Nathaniel Miller die Surface-Topography Challenge. Mithilfe der Technologie, die auch bei der Herstellung von Mikrochips verwendet wird, fertigte das Team zwei reale Testoberflächen – eine relativ glatte, eine deutlich rauere – und beschichtete beide mit Chromnitrid. Die Proben wurden in großer Stückzahl hergestellt, und weltweit an interessierte Forschende verschickt. Jede teilnehmende Gruppe durfte selbst entscheiden, mit welchen Geräten und Methoden sie die Oberflächen vermessen wollte. Anschließend sollten die unbearbeiteten Rohdaten zentral hochgeladen werden.
Zunächst befürchtete das Team eine geringe Beteiligung – doch es kam ganz anders: Mehr als 150 Personen aus Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen machten mit. Insgesamt kamen 64 Gruppen aus 20 Ländern zusammen und lieferten 2.088 einzelne Messungen.
„Die hohe Beteiligung an der Surface-Topography Challenge zeigt das große Interesse daran, unser Verständnis von Oberflächenrauheit zu verbessern“, sagt Müser.
„Die theoretische Modellbildung hat große Fortschritte gemacht, wenn es darum geht, das Verhalten rauer Oberflächen vorherzusagen“, erklärt Pastewka. „Aber diese Fortschritte lassen sich oft kaum auf reale Anwendungen übertragen, weil es an präzisen Messdaten fehlt. Jetzt haben wir tausende reale Messungen zweier bekannter Oberflächen – und damit endlich praktische Anhaltspunkte, wie sich Theorie in der Praxis umsetzen lässt. Die Resonanz aus der Forschungsgemeinschaft war wirklich beeindruckend.“
Der Weg zu einer zuverlässigeren Beschreibung von Rauheit
Eine Schlüsselrolle spielte Arushi Pradhan, Jacobs’ Doktorandin. „Sie hat die Daten so ausgewertet, dass sich daraus überhaupt erst Erkenntnisse gewinnen ließen“, erklärt Jacobs. „Bei unseren Treffen brachte sie entscheidende Analysen ein – ohne sie hätten wir diese Studie nicht abschließen können.“
Die Ergebnisse zeigten, wie unterschiedlich die Messungen ausfielen – je nach verwendetem Verfahren. Beim metrischen Standardwert RMS-Höhe (Root Mean Square Height) etwa wichen die Werte zwischen verschiedenen Gruppen um den Faktor 1.000.000 voneinander ab!
„Die Daten zeigen, wie schwer es ist, sich auf eine Beschreibung der Oberflächentopografie zu einigen“, sagt Pradhan. „Wir mussten Störeinflüsse, Artefakte und Auflösungsgrenzen korrigieren. Aber durch die Vielzahl der Messungen konnten wir einer objektiven, 'wahren' Beschreibung näherkommen.“
Jacobs ist sich bewusst, dass es für Unternehmen nicht praktikabel ist, zehn oder mehr Messmethoden anzuwenden. Aber schon zwei oder drei unterschiedliche Ansätze – auf verschiedenen Skalen – verbessern die Ergebnisse deutlich.
„Dieser Wettbewerb war nicht nur für ein paar Oberflächenforscher*innen gedacht“, betont Jacobs. „Sie richtet sich an alle, die mit funktionalen Eigenschaften von Oberflächen zu tun haben. Unser Ziel ist es, die besten Metriken zu finden – also Kennwerte, die sich in Forschung, Produktentwicklung und Qualitätssicherung gleichermaßen einsetzen lassen, um Oberflächen gezielt zu verbessern.“
Auch wenn der eigentliche Wettbewerb inzwischen beendet ist, verschickt das Team weiterhin Proben an interessierte Forschungseinrichtungen: https://contact.engineering/challenge. Diese Proben können als Referenz oder Benchmark für alle dienen, die regelmäßig Oberflächen messen.
„Für uns ist das kein Abschluss“, sagt Jacobs. „Die Topografie von Oberflächen ist entscheidend für ihre Funktion – aber das Thema ist noch längst nicht gelöst. Dieser Wettbewerb war erst der Anfang.“
DANKSAGUNG
Die Entwicklung und Organisation der Surface Topography Challenge wurde unterstützt durch die US National Science Foundation (CAREER-1844739 und CMMI-2400999), die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, EXC-2193/1-390951807) sowie den Europäischen Forschungsrat (ERC, StG 747343).
Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Lars Pastewka
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)
Simulation
E-Mail: lars.pastewka@imtek.uni-freiburg.de
Kerstin Steiger-Merx
Referentin PR/Marketing
Technische Fakultät
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Tel.: 0761/203-8056
E-Mail: steiger-merx@tf.uni-freiburg.de
28.07.2025